

Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. (404)
Die gewünschte Seite wurde nicht gefunden. Vermutlich haben Sie einen veralteten Link verwendet oder die URL nicht korrekt eingegeben.
Möglicherweise finden Sie das Gesuchte schon in diesem Angebot:
Suche
Besuch und Service
Ausstellungen
Veranstaltungen
Über uns
Bildung und Vermittlung
Museumsladen
Förderverein
Kulturreferat
oder Sie starten auf:
www.schlesisches-museum.de
Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstraße 8, Untermarkt 4, D-02826 Görlitz
Telefon +49 3581 8791-0, Fax +49 3581 8791-200
kontakt@schlesisches-museum.de
www.schlesisches-museum.de
Führungen für Gruppen
Eintritt + 30 Euro an Wochentagen
bzw. 40 Euro an Wochenenden und Feiertagen,
Kurzführungen pauschal 25 Euro,
Audioguides deutsch, polnisch, englisch
(im Eintritt inbegriffen)
Öffnungszeiten
Dienstag–Donnerstag 10 bis 17 Uhr
Freitag–Sonntag 10 bis 18 Uhr
Sonderöffnungszeiten im ersten Quartal und an Feiertagen
Eintritt
Dauerausstellung 7 €, ermäßigt 5 €
Sonderausstellung 3 €, ermäßigt 2,50 €
Freier Eintritt für Besucher bis 16 Jahre
und an jedem ersten Sonntag im Monat
Gefördert durch:
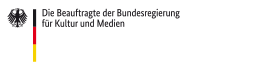

Mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Impressum | Datenschutz | © Schlesisches Museum zu Görlitz
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.
